Newsletter-Seite
Ältere Newsletter finden Sie im Archiv >>

04 | 2025
NEUIGKEITEN
Umsetzung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat einen Entwurf für ein Gesetz zur Umsetzung der EU Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer (RL/EU 2024/1712) vorgelegt. Ziel des Entwurfs ist insbesondere die Stärkung der strafrechtlichen Verfolgung von Menschenhandel. Im Rahmen der Verbändebeteiligung hat der KOK eine Stellungnahme zu dem Entwurf vorgelegt. Darin bewertet der KOK zunächst positiv, dass mit dem Gesetzesentwurf nicht nur die verpflichtenden Vorgaben der reformierten EU-Menschenhandelsrichtlinie umgesetzt, sondern eine umfassende Überarbeitung der Menschenhandelstatbestände vorgenommen wird.
Der Entwurf weist jedoch auch deutliche Lücken auf. Zentrale Vorgaben der EU-Richtlinie zum Schutz und zu den Rechten von Betroffenen fehlen. Der Fokus liegt auf der Strafverfolgung. Verpflichtungen zu Schutz, Unterstützung und Zugang zu Leistungen sind unzureichend berücksichtigt.
Der KOK kritisiert außerdem das Fehlen einer gesetzlich vorgesehenen Evaluierung. Ohne eine Überprüfung bleibt unklar, ob die beabsichtigten Reformen tatsächlich zu einer verbesserten Anwendung der Regelungen führen.
Weitere Akteure äußerten sich zu dem vorgelegten Entwurf:
Die Berichterstattungsstelle Menschenhandel am Deutschen Institut für Menschenrechte benennt zentrale Stärken und Mängel des Entwurfs. Sie lobt ebenso wie der KOK die geplante umfassende Neufassung der Straftatbestände, die Ausweitung der Ausbeutungsformen auf Zwangsheirat, Leihmutterschaft und illegale Adoption sowie den Ersatz des Begriffs „Zwangslage“ durch „schutzbedürftige Lage“. Das könne Strafbarkeitslücken schließen. Gleichzeitig kritisiert sie unzureichenden Betroffenenschutz und fordert eine verbindliche Anwendung des Non-Punishment-Prinzips, kostenlose Rechtsvertretung für Betroffene, sichere Aufenthaltsrechte für Drittstaatsangehörige und effektive Unterstützungsangebote.
Der Deutsche Juristinnenbund (djb) begrüßt wichtige Verbesserungen im neuen Gesetzesentwurf. Zugleich warnt er vor einer problematischen Vermischung von Sexarbeit mit sexualisierter Gewalt. Der Schutz sexueller Selbstbestimmung dürfe nicht verwässert werden. Ein pauschales Sexkaufverbot sieht der djb kritisch. Er fordert stattdessen ein klares, konsensbasiertes Sexualstrafrecht mit wirksamen Ausstiegswegen und echtem Opferschutz.
Die Bundeskoordinierung spezialisierter Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend (BKSF) unterstützt das Ziel, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung strafrechtlich klarer und schärfer zu fassen. Sie weist aber darauf hin, dass Strafrecht allein nicht ausreiche. Für ihre Arbeit mit Betroffenen betonen sie, dass Prävention, Intervention und Hilfestrukturen genauso wichtig seien wie Strafverfolgung.
Internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen
Das BKA veröffentlichte kurz vor dem Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen, der am 25.11. begangen wird, die jährlichen Lagebilder Häusliche Gewalt und Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten. Beide Lagebilder kommen zu dem Ergebnis, dass die Fallzahlen von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt weiter steigen.
Auch die Vereinten Nationen veröffentlichten neue Zahlen zu Gewalt gegen Frauen und zu Femiziden. Demnach wird etwa alle zehn Minuten eine Frau oder ein Mädchen Opfer tödlicher Gewalt innerhalb der Familie oder in Beziehungen.
Die Problematik sowie die veröffentlichten Zahlen wurden von verschiedenen Akteuren anlässlich des 25.11. aufgegriffen:
Der Deutsche Juristinnenbund (djb) weist auf die alarmierende Zunahme digitaler Gewalt gegen Frauen hin. Der djb fordert ein umfassendes Bewusstsein für digitale Gewalt und deren strafrechtliche Anerkennung als reale Gewalt, mehr Wissen zum Thema und zur Verfolgung digitaler Gewalt bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten sowie eine bessere Finanzierung von Fachberatungsstellen.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e.V. fordert in ihrer Stellungnahme strukturelle Lösungen angesichts struktureller Gewalt. So sollte die Überwindung von Gewalt gegen Frauen ins Zentrum politischer Entscheidungsprozesse gestellt und auf allen Ebenen konsequent vorangetrieben werden. Die BAG fordert ganzheitliche Ansätze, den Ausbau von geschlechtersensibler Primärprävention und der Abbau der Benachteiligung von Frauen bei Bildung, Arbeit und politischer Teilhabe, in der Gesundheitsversorgung und beim Wohnen.
Das Gunda-Werner-Institut widmet sich in Kooperation mit der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (ZIF) dem Themenschwerpunkt „Geschlechtsspezifische Gewalt und der Einfluss antifeministischer Väterrechtler“ in der Mediathek Antifeminismus begegnen. Die Beiträge verdeutlichen die Verankerung geschlechtsspezifischer Gewalt in patriarchalen Strukturen und thematisieren die besonders betroffenen Gruppen, darunter Frauen sowie trans*, inter* und nicht-binäre Personen. Zudem werden aktuelle menschenrechtliche Rahmenbedingungen, wie die Istanbul-Konvention, diskutiert und der unzureichende Schutz marginalisierter Personen trotz rechtlicher Vorgaben beleuchtet.
Eurostat Bericht: Zehn Jahre EU-Daten zum Menschenhandel
Eurostat hat am 13. Oktober einen Bericht veröffentlicht, der die Daten zum Menschenhandel in der EU über einen Zeitraum von zehn Jahren (2013–2023) analysiert. Demnach wurden in diesem Zeitraum über 83.000 Betroffene von Menschenhandel registriert. Die sexuelle Ausbeutung bleibt laut Bericht weiterhin die häufigste Form des Menschenhandels, jedoch sind die Fälle von Arbeitsausbeutung seit 2019 um 70,5 % gestiegen. Die Mehrheit der registrierten Betroffenen war weiblich, der Anteil männlicher Betroffener ist aber über die Jahre gestiegen. Die Zahl der Betroffenen aus Nicht-EU-Ländern hat sich innerhalb des letzten Jahrzehnts verdreifacht.
Laut Bericht hat die Zahl der Betroffenen von Menschenhandel insgesamt im Laufe der Jahre deutlich zugenommen. Dieser Anstieg könne auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, bspw. veränderte Methoden zur Identifizierung, verbesserte nationale Datenerhebungsverfahren, aber auch auf einen tatsächlichen Anstieg der Fallzahlen.
Start der Bavarian Anti-Trafficking HELPline
Zum Europäischen Tag gegen Menschenhandel am 18. Oktober hat die STOP dem Frauenhandel gGmbH mit der Bavarian Anti-Traffkicking HELPline, einer digitalen Anlaufstelle zu Menschenhandel in Bayern, ein Pilotprojekt gestartet. Mit dem neuen Angebot soll bayernweit ein niedrigschwelliger Zugang zu Beratung und Unterstützung - sowohl für potenziell Betroffene als auch für ihr Umfeld und Fachkräfte geschaffen werden. Die HELPline bietet hierbei kostenlose und vertrauliche Beratung per Telefon, Chat und E-Mail an. Zudem bietet die Website ein anonymes Online-Meldeformular für Verdachtsfälle. Die HELPline arbeitet nach den Qualitätsstandards des KOK und wird durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.
ECPAT Kampagne „Zu nah zum Wegsehen“
Die Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung (ECPAT Deutschland) hat am 18. Oktober die bundesweite Aufklärungskampagne #ZuNahZumWegsehen zum Thema Menschenhandel mit Minderjährigen gestartet. Ziel der Kampagne ist es, junge Menschen über Formen von Ausbeutung aufzuklären und konkrete Hilfsangebote aufzuzeigen. Entwickelt wurde die Kampagne gemeinsam mit Jugendlichen, um Inhalte zu schaffen, die ihre Lebensrealität widerspiegeln und direkt ansprechen. Mit Beiträgen auf TikTok und Instagram sowie ergänzenden Materialien auf der ECPAT-Website sollen Wissen und Handlungsmöglichkeiten niedrigschwellig vermittelt werden.
UN-Generalversammlung bekräftigt globale Entschlossenheit zur Beendigung des Menschenhandels
Die UN-Generalversammlung hat am 24. November eine umfassende politische Erklärung verabschiedet, die den weltweiten Einsatz zur Beendigung des Menschenhandels bekräftigt. Mit der Erklärung „On the Implementation of the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons“ verurteilen die UN Menschenhandel als schweres Verbrechen und betonen u.a. die Notwendigkeit einer engeren internationalen Zusammenarbeit, einschließlich des Informationsaustauschs zwischen den Staaten, mehr Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und dem privaten Sektor, einschließlich Technologieunternehmen, einer besseren Durchsetzung von Strafverfolgung sowie größerer Anstrengungen um zu verhindern, dass Migrant*innen in ausbeuterische Situationen geraten.
Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage der Grünen zu Menschenhandel
In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Umsetzung der EU-Richtlinie Menschenhandel geht die Bundesregierung auf verschiedene Fragen ein, u.a. nach den Plänen für eine Verstetigung der Berichterstattungsstelle Menschenhandel. Hierzu sei die Bundesregierung im engen Austausch. Zu der Zahl der erteilten Bedenkfristen für Betroffene von Menschenhandel liegen laut Bundesregierung keine Informationen vor, bzw. lediglich zu den durch die FKS in 37 Fällen ausgelösten Bedenkfristen. Zu den Aufenthaltstiteln für Betroffene von Menschenhandel teilt die Bundesregierung mit, dass zum Stichtag 31. Oktober 2025 seit 2020 insgesamt nur 241 Erteilungen von Aufenthaltserlaubnissen nach § 25 Abs. 4a AufenthG für 120 betroffene Personen von Menschenhandel und Ausbeutung gespeichert worden sind.
Rat der EU legt Standpunkt zum Gesetz über den Schutz von Kindern vor Missbrauch im Internet fest
Vertreter*innen der EU-Mitgliedstaaten einigten sich auf einen Standpunkt des Rates zu einer Verordnung zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern online. Mit der Verordnung sollen Digitalunternehmen verpflichtet werden, die Verbreitung von Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder und die Kontaktaufnahme zu Kindern zu verhindern. Die zuständigen nationalen Behörden sollen in der Lage sein, Unternehmen zur Sperrung des Zugangs bzw. zur Entfernung entsprechender Inhalte oder – im Falle von Suchmaschinen – zur Streichung von Suchergebnissen zu verpflichten. Mit der Verordnung wird auch eine neue EU-Agentur, das EU-Zentrum für die Prävention und Bekämpfung sexuellen Kindesmissbrauchs, geschaffen, um die Mitgliedstaaten und Online-Anbieter bei der Umsetzung der Vorschriften zu unterstützen. Die erzielte Einigung ist die Grundlage für den Rat, Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament aufzunehmen, um eine Einigung über die endgültige Verordnung zu erzielen.
Kinder und Jugendliche als Betroffene von Menschenhandel in Deutschland
Zum Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und Gewalt am 18. November weist die Berichterstattungsstelle Menschenhandel des Deutschen Instituts für Menschenrechte daraufhin, dass es zu wenig Fachwissen gibt, um minderjährige Betroffene von Menschenhandel zu schützen. Während das Lagebild Menschenhandel des BKA 246 betroffene Minderjährige im Jahr 2024 registrierte, wird die Dunkelziffer deutlich höher eingeschätzt. Die bereits am 18. Oktober veröffentlichte Studie „Durchs Raster gefallen“ der Berichterstattungsstelle befasst sich eingehend mit der Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Co-Autorin Anna Bußmann fordert in einem Interview anlässlich des Aktionstags am 18. November die Etablierung spezialisierter Beratungsstellen und eine intensivere Kooperation der zuständigen Behörden. Für die Studie stellten zahlreiche KOK-Mitgliedsorganisationen ihre Expertise zur Verfügung.
Bündnis Istanbul-Konvention legt umfassenden Bericht vor
Das Bündnis Istanbul-Konvention (BIK), dem auch der KOK angehört, hat einen umfassenden Alternativbericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland veröffentlicht und GREVIO (Expert*innengruppe des Europarates für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt) vorgelegt. Das BIK bescheinigt in dem Bericht massive Lücken beim Schutz vor geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt in Deutschland und das Fehlen einer klaren Verbindlichkeit bei der bundesweiten Umsetzung der Maßnahmen. Der Bericht enthält eine Reihe von Empfehlungen, u.a. einen Paradigmenwechsel in Bezug auf die Finanzierung von Hilfsangeboten und eine verbindliche, langfristige und intersektional ausgerichtete Gesamtstrategie gegen Gewalt an Frauen. Erarbeitet wurde der Bericht unter Einbezug von Fachstellen, Selbstorganisationen und Betroffenenperspektiven.
Neue Wissensplattform der Frauenhauskoordinierung e.V.
Um Fachkräfte im Hilfesystem zu sensibilisieren und Betroffene beim Schutz vor digitaler Gewalt zu unterstützen, veröffentlichte die Frauenhauskoordinierung e.V. die Wissensplattform „Sicher gegen digitale Gewalt“. Sie informiert über verschiedene Formen digitaler Gewalt – mit Fokus auf Ex-Partnerschaftsgewalt – und stellt Fachwissen, Praxistipps sowie Arbeitsmaterialien bereit. So sollen digitale Sicherheit gestärkt und Betroffene wirksam unterstützt werden können.
Versorgung traumatisierter Geflüchteter
Die Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosoziale Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer – BAfF e. V. macht in einem Policy Paper auf die Problematik der sehr prekären Finanzierung Psychosozialer Zentren für Geflüchtete, u.a. durch vorgesehene Kürzungen von Bundesmitteln und drohenden Lücken bei der EU-Finanzierung aufmerksam. Die BAfF fordert eine verlässliche Finanzierung, eine bedarfsorientierte Verteilung der EU Mittel und langfristige strukturelle Lösungen.
VERÖFFENTLICHUNGEN DES KOK
Gutachten Steuerschuld von Zwangsprostituierten
Die Beratungspraxis zeigt, dass Täter*innen in Fällen sexueller Ausbeutung häufig die Identitäten der Betroffenen missbrauchen, um fiktive Steuererklärungen einzureichen oder Einnahmen aus erzwungener Prostitution zu verschleiern. Für die Betroffenen entstehen daraus erhebliche steuerliche Belastungen. Nach der Ausbeutung werden ihnen rückwirkend Steuerschulden zugerechnet, obwohl sie keine Kenntnis der Vorgänge hatten und selbst kaum oder keine Einkünfte erzielten. Die Steuerfahndung leitet zudem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Einkommen, Umsatz und Gewerbesteuerhinterziehung ein.
Der KOK hat daher ein Gutachten in Auftrag gegeben, in dem Autor und Rechtsanwalt Felix Wiesner die steuerlichen und steuerstrafrechtlichen Folgen, die sich für Betroffene ergeben, die im Kontext der Ausbeutung unfreiwillig Einkünfte erwirtschaften mussten untersucht. Das Gutachten steht hier zum Download zur Verfügung.
KOK-Themenpapier zur Arbeit der Fachberatungsstellen
Mit dem Themenpapier hat der KOK ein neues Format veröffentlicht. Darin werden künftig verschiedene Aspekte zu Menschenhandel und Ausbeutung in komprimierter und gut zugänglicher Form für eine breite Öffentlichkeit aufbereitet. Das Format bietet eine klare Struktur mit verständlichen Erläuterungen und bietet Hinweise zu weiterführenden Informationen.
Das erste Themenpapier stellt die Arbeit der spezialisierten Fachberatungsstellen vor.
Spezialisierte Fachberatungsstellen sind die wichtigsten Akteure, wenn es um Schutz und Unterstützung für Betroffene von Menschenhandel geht. Sie beraten Betroffene von Menschenhandel kostenlos, vertraulich und meist in ihrer Erstsprache. Die Beratung ist unabhängig von einer möglichen Anzeige. Im Mittelpunkt stehen die Interessen und Rechte der Betroffenen und eine nachhaltige Verbesserung ihrer Lebenssituation.
Das Papier gibt einen Überblick über:
- Leistungen der spezialisierten Fachberatungsstellen
- Übersicht darüber, wie die Begleitung von Betroffenen aussieht
- Leitmotive und Qualitätsstandards der spezialisierten Fachberatungsstellen
- Forderungen des KOK zum Ausbau des Unterstützungs- und Hilfesystems
Jahresrückblick
Mit der Verabschiedung des Nationalen Aktionsplans Menschenhandel (NAP MH) und des Nationalen Aktionsplans gegen Arbeitsausbeutung und Zwangsarbeit (NAP AZ) hat die Bundesregierung zentrale Maßnahmen gegen Menschenhandel auf den Weg gebracht. Der KOK hat den Prozess intensiv begleitet und seine Einschätzung aus zivilgesellschaftlicher Perspektive im Sommer 2025 veröffentlicht.
Mit den beiden Aktionsplänen liegt erstmals ein umfassender Rahmen vor, die Maßnahmen verschiedener Ressorts zu bündeln. Damit sie jedoch Wirkung entfalten können, braucht es klare Zuständigkeiten, ausreichende Ressourcen und eine verbindliche Umsetzungsstrategie zwischen Bund und Ländern. Der KOK fordert, Prioritäten und Zeitpläne transparent zu machen und die Koordinierung zu stärken. Nur so können die guten Ansätze in der Praxis ankommen und Betroffene tatsächlich profitieren.
Der Blick in die Praxis zeigt, wie lange und engagiert Fachberatungsstellen bereits tätig sind. Die Jubiläen unserer Mitglieder stehen für langjährige Erfahrung, verlässliche Strukturen und kontinuierlichen Einsatz für den Schutz und die Unterstützung Betroffener.
Diese und weitere wichtige Entwicklungen, Veranstaltungen, Aktivitäten und Veröffentlichungen stellt der KOK in seinem übersichtlichen Jahresrückblick 2025 dar.
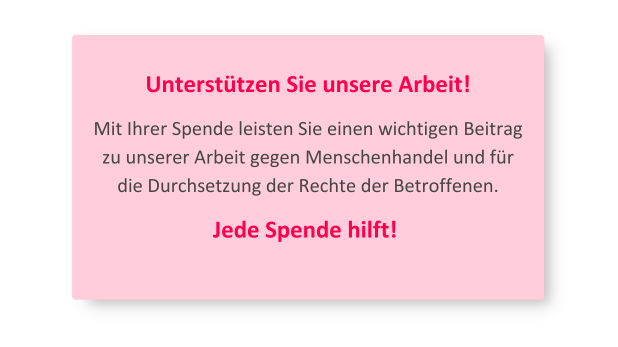
Jetzt ganz einfach für den KOK spenden:
- per Überweisung auf unser Spendenkonto: Evangelische Bank eG, IBAN: DE43 5206 0410 0003 9110 47, BIC: GENODEF1EK1
- mit jedem Einkauf automatisch spenden über wecanhelp.de
- über das Spendenformular auf unserer Webseite
KOK-VERANSTALTUNGEN
Gemeinsamer Praxisfachtag von KOK und BKA
Vom 01.–02. Dezember trafen sich Vertreter*innen von Polizei und von spezialisierten Fachberatungsstellen für Betroffene von Menschenhandel beim gemeinsam von KOK und BKA organisierten Praxisfachtag in Wiesbaden. Schwerpunkt des Treffens war das Thema Menschenhandel aus lateinamerikanischen Ländern. Die Teilnehmer*innen hatten die Möglichkeit, sich zu aktuellen Entwicklungen und Tendenzen auszutauschen und über Kooperationserfordernisse zu diskutieren.
VERANSTALTUNGEN
Fachtag Menschenhandel mit vietnamesischen Betroffenen
Die Fachberatungsstelle IN VIA feierte am 27. November das 15-jähriges Bestehen der Koordinations- und Beratungsstelle für Frauen, die von Menschenhandel betroffen sind in Brandenburg, sowie das Projekt Streetwork – HIV/Aids-Prävention und Beratung für Sexarbeitende im Land Brandenburg und im grenzüberschreitenden Raum Polen.
Im Rahmen eines Fachtages in Potsdam unter dem Titel „Menschenhandel mit vietnamesischen Betroffenen – Herausforderungen und Handlungsansätze“ kamen Expert*innen aus Behörden, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen, um die Situation vietnamesischer Betroffener von Menschenhandel zu beleuchten – einer besonders vulnerablen und oft übersehenen Gruppe.
Treffen der EU Civil Society Platform
Vom 15.–16. Dezember trafen sich die Mitglieder der Zivilgesellschaftlichen EU-Plattform gegen Menschenhandel in Brüssel. Zum Auftakt fand am 15.12. ein gemeinsames Treffen mit dem EU-Netzwerk Nationaler Koordinator*innen für die Bekämpfung des Menschenhandels statt. Schwerpunktthema des Austauschs war die neue EU-Strategie zur Bekämpfung des Menschenhandels, die aktuell erarbeitet wird und 2026 verabschiedet werden soll. Die neue Strategie baut auf dem strategischen Rahmen der EU für den Zeitraum 2021–2025 auf und soll Prävention, Opferschutz, das Vorgehen gegen kriminelle Netzwerke und die Verbesserung der Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und Nicht-EU-Ländern einbeziehen. Der KOK ist Mitglied der Plattform.
Orange Days
Mit einer Veranstaltungsreihe beteiligt sich der Paritätische Gesamtverband an den Orange Days, einer UN-Kampagne, die seit 1991 auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam macht. Sie startet am Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen am 25. November und endet am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte. Der KOK war bei der Veranstaltung „Menschenhandel – betrifft auch Kinder und Jugendliche“ mit einem Input vertreten.
40 Jahre CEDAW
Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Ratifizierung der UN-Frauenrechtskonvention CEDAW lud das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend am 12. Dezember zur Jubiläumsveranstaltung „40 Jahre Ratifizierung der UN-Frauenrechtskonvention in Deutschland – ein Grund zu feiern!?“ ein. Neben den Errungenschaften seit der Ratifizierung, auf die Bundesministerin Karin Prien in ihren Grußworten hinwies, wurden in verschiedenen Workshops auch noch bestehende Herausforderungen und Handlungsnotwendigkeiten diskutiert.
RECHTLICHE ENTWICKLUNGEN
Gesetz zur Stärkung der Strafverfolgung bei Menschenhandel und sexueller Ausbeutung
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat den Referentenentwurf zur Umsetzung der überarbeiteten EU-Richtlinie gegen Menschenhandel vorgelegt. Diese muss bis Juli 2026 in nationales Recht umgesetzt werden. Der KOK und weitere Akteure haben Stellungnahmen zum Entwurf eingereicht (siehe unter Neuigkeiten).
GEAS-Anpassungsgesetz
Der Gesetzentwurf (Drucksache 21/1848 und Drucksache 21/1850) zur Umsetzung der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) stieß in der Anhörung am 03. November im Innenausschuss des Bundestages auf starke Kritik. So wies Annika Fischer-Uebler vom Deutschen Institut für Menschenrechte beispielsweise darauf hin, dass der Entwurf die europarechtlichen Spielräume zugunsten von Schutzsuchenden nicht ausschöpfe, sondern vor allem Einschränkungen von Rechten Geflüchteter vorantreiben. Freiheitsbeschränkungen und Inhaftierungen drohen so zur Regel zu werden. Zudem enthalte der Entwurf Bestimmungen, die über die GEAS-Reform hinausgingen und damit das Risiko bergen, die Menschenrechte von Geflüchteten und Migrant*innen zu verletzen. Auch andere Sachverständige forderten den Schutz besonders vulnerabler Personen stärker zu berücksichtigen und die gesetzlichen Vorgaben klarer zu gestalten. Sie wiesen auf mögliche Verfahrensverzögerungen sowie zusätzliche Belastungen für die Behörden hin. Andere Sachverständige stellten Nachsteuerungsbedarf fest und wiesen auf die Herausforderungen in der Umsetzung für Städte, Gemeinden und Kommunen hin.
Die Aufzeichnung der Anhörung sowie die Stellungnahmen aller Sachverständigen sind auf der Website des Innenausschusses zu finden.
Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten per Rechtsverordnung
In seiner Sitzung am 03. Dezember hat der Innenausschuss des Bundestages über den „Entwurf eines Gesetzes zur Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten durch Rechtsverordnung und Abschaffung des anwaltlichen Vertreters bei Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam“ von CDU/CSU und SPD in geänderter Form abgestimmt. Durch das Gesetz kann die Bundesregierung zukünftig für internationalen Schutz nach §§ 3 und 4 des Asylgesetzes (Schutz nach der GFK und subsidiärer Schutz) per Rechtsverordnung – und nicht mehr per Gesetz – darüber bestimmen, ob ein Herkunftsstaat als sicher gilt. Das bedeutet, Bundestag und Bundesrat müssen nicht im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens beteiligt werden. Der Entwurf wurde u.a. von PRO ASYL scharf kritisiert. Die Einstufung als sichere Herkunftsstaaten bedeute eine Abschwächung des individuellen Grundrechts auf Asyl und des Flüchtlingsschutzes für die betroffene Person. Um dieser grundrechtsrelevanten Bedeutung gerecht zu werden, ist daher eine gesetzliche Bestimmung durch Bundestag und Bundesrat folgerichtig, so PRO ASYL. Das Gesetz wurde vom Bundestag am 05. Dezember in der vom Innenausschuss beschlossenen Fassung angenommen.
EU-Innenminister*innen einigen sich auf Asylverschärfungen
Die Innenminister*innen der EU einigten sich am 08. Dezember auf Verschärfungen in der Asylpolitik mit Zustimmung zum Vorschlag der EU-Kommission für ein Gemeinsames Europäisches Rückkehrsystem, dessen erklärtes Ziel es ist, Abschiebungen zu vereinfachen und zu beschleunigen. So sollen einheitliche Verfahren in Bezug auf Abschiebehaft, Wiedereinreiseverbot und strenge Kooperationsverpflichtungen für ausreisepflichtige Personen mit EU-Behörden gelten. Zudem wurde die Liste der sicheren Herkunftsländer erweitert und sich auf ein Konzept für „sichere Drittstaaten“ geeinigt, in die künftig abgelehnte Asylsuchende leichter abgeschoben werden können, auch wenn keinerlei Verbindung - etwa durch Familie oder Freund*innen - dorthin besteht. Das EU-Parlament muss diesen Beschlüssen noch zustimmen.
Die Platform for International Cooperation on Undocumented Mirgants (PICUM), zu der auch der KOK gehört, kritisiert die Einigung in einem Statement als ein Abschiebungsregime, das Bestrafung, Gewalt und Diskriminierung festigt, anstatt in Sicherheit, Schutz und Inklusion zu investieren. Auch im Migazin oder im Deutschlandfunk werden Stimmen wiedergegeben, die die geplanten Regelungen als drastische Einschränkung bzw. quasi Abschaffung des Asylrechts kritisieren.
INFORMATIONSMATERIAL UND PUBLIKATIONEN
Aide Mémoires des Forum Menschenrechte
Zum internationalen Tag der Menschenrechte veröffentlicht das Forum Menschenrechte seine Aide Mémoires, die dem Außenminister Dr. Johann Wadephul bereits am 19. November 2025 übergeben wurden. Die Aide Mémoires bündeln Fachwissen aus über fünfzig Organisationen. Sie geben einen klaren Überblick über Menschenrechtsrisiken in Herkunftsländern und zeigen, wo politisches Handeln nötig ist. Sie dienen Ministerien, Botschaften und politischen Entscheidungsträger*innen als konkrete Grundlage, um Schutzlücken zu erkennen und wirksame Maßnahmen einzuleiten.
Der KOK hat in einem der Aide Mémoires die Auswirkung der Anerkennung von sicheren Herkunftsstaaten auf die Lage von Betroffenen von Menschenhandel und Zwangsheirat am Beispiel der Balkanstaaten geschildert.
La Strada Publikationen zum Thema Ausbeutung von Leihmutterschaft
Nach der Aufnahme der Ausbeutung durch Leihmutterschaft in die überarbeitete EU-Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels führte La Strada International (LSI) eine Untersuchung durch, um zu analysieren wie Leihmutterschaft in Europa geregelt ist und welche Verbindungen zwischen Leihmutterschaft und Menschenhandel bestehen. Die vergleichende Studie „Comparative Analysis of the Legal and Policy Landscape on (Trafficking for the Exploitation of) Surrogacy Across Europe“ stellt die Rechtslage in 38 europäischen Ländern dar.
In einer zweiten Publikation beschäftigt sich LSI mit der Frage, vor welchem Hintergrund die Ausbeutung von Leihmutterschaft als Form des Menschenhandels in die überarbeitete EU-Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels (Richtlinie (EU) 2024/1712) aufgenommen wurde.
Menschenrechtsbericht des DIMR
Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat seinen jährlichen Bericht über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland 2024/25 veröffentlicht. Der zehnte Bericht zur Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland umfasst den Zeitraum 1. Juli 2024 – 30. Juni 2025 und beschäftigt sich in diesem Jahr u.a. mit den Themen Schutz von Betroffenen von Menschenhandel und Gefahren für den Rechtsstaat und die für ihn unverzichtbare Zivilgesellschaft. Der Bericht liegt als Langfassung und als Kurzfassung vor. Die Menschenrechtsberichte werden auch dem Bundestag vorgelegt.
Datenschutzhandbuch zu Asyl und Migration in Europa
Die NGO Statewatch hat das Handbuch „Dataprotection Handbook on Asylum and Migration in Europe“ veröffentlicht. Es beschäftigt sich mit der Frage, wie Datenschutzrechte genutzt werden können, um Rechtsbehelfe und Entschädigungen für Menschen im Migrations- und Asylsystem der EU zu erwirken. Es richtet sich an verschiedene Fachakteure, die sich mit Migrations- und Asylfällen befassen.
Ausbeutung in der Pflege
Das europäische Netzwerk EUROCARERS, das informell arbeitende Pflegekräfte und ihre Organisationen vertritt, beleuchtet in seinem Policy Paper „Integrating migrant care into European and national long-term care strategies: Eurocarers’ concerns and recommendations“ die Pflegearbeit von Migrant*innen und bezieht dabei die Perspektive informelle arbeitender Pflegekräfte mit ein. Es warnt davor, dass die derzeitige Situation die Rechte der Arbeitnehmer*innen untergräbt und die Qualität der Pflege für Bedürftige beeinträchtigt – was den Zielen der Europäischen Pflegestrategie zuwiderläuft.
Veröffentlichung des Mediendienstes Integration zu Abschiebung und Abschiebungshaft
Der Mediendienst Integration hat die Publikation „Abschiebung und Abschiebungshaft im Fokus. Wirkung und aktuelle Entwicklungen“ veröffentlicht. Sie bereitet Rechtslage, Entwicklungen und statistische Daten übersichtlich auf. Grundlage sind Erhebungen der Landesministerien für den Zeitraum von 2021 bis Mitte 2025. Die Analyse zeigt: Die Zahl der Inhaftierungen in größeren Abschiebehafteinrichtungen stieg zwischen 2021 und 2024 um rund 63 Prozent. Allerdings besteht kein direkter Zusammenhang zwischen der Zahl der Inhaftnahmen und den tatsächlich vollzogenen Abschiebungen – nicht jede inhaftierte Person wird letztlich auch abgeschoben.
NEUIGKEITEN AUS DER KOK-RECHTSPRECHUNGSDATENBANK
BGH sieht auffälliges Missverhältnis zu deutschen Arbeitnehmer*innen und bestätigt Verurteilung eines kriminellen Leiharbeitsnetzwerkes
Der Bundesgerichtshof bestätigt in einem Beschluss vom 11. September 2024 die Verurteilung von insgesamt sechs Angeklagten wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländer*innen, Urkundenfälschung, Beschäftigung von Ausländer*innen ohne Aufenthaltstitel und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen sowie wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt. Die Angeklagten waren Teil eines kriminellen Netzwerks, das über mindestens fünf Jahre hunderte Personen ohne Aufenthaltsberechtigung aus dem Nicht-EU-Ausland als Leiharbeiter*innen in der Logistikbranche in Deutschland beschäftigte. Dafür wurden ID-Karten und A1-Bescheinigungen gefälscht. Sie wurden zu schlechten Arbeitsbedingungen und zumeist ohne Sozialversicherungsbeiträge beschäftigt. In Deutschland wurden dadurch Sozialversicherungsabgaben in Höhe von mehreren Millionen EUR hinterzogen. Die Täter*innen haben dadurch enorme Profite erzielt, weshalb auch die Einziehungsbeträge zum Teil im Millionenbereich lagen.
Der BGH macht zudem umfangreiche Ausführungen dazu, wann ein auffälliges Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen deutscher Arbeitnehmer*innen vorliegt und bekräftigt seine Rechtsprechung aus dem Jahr 2017. Die Feststellung eines auffälligen Missverhältnisses erfordere eine Gesamtschau aller Arbeitsbedingungen wie Lohn, Urlaub, soziale Absicherung, Schutz vor Arbeitsunfällen und Kündigung. Das bloße Nichtanmelden zur Sozialversicherung reiche jedoch nicht.
Möchten Sie regelmäßig über neue Entscheidungen informiert werden? Dann lassen Sie sich gerne in unseren Verteiler aufnehmen! Schreiben Sie einfach eine kurze E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse an: rechtsprechung@kok-buero.de
RUBRIK WISSEN – NATIONALER VERWEISUNGSMECHANISMUS
Das Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR, Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) veröffentlichte 2004 erstmals ein Handbuch mit Empfehlungen zur Etablierung von Nationalen Verweisungsmechanismen in Fällen von Menschenhandel (National Referral Mechanism oder auch NRM) vorgestellt und 2024 in aktualisierter Form veröffentlicht.
Ein NRM ist ein kooperativer, nationaler Rahmen, der den beteiligten Akteuren helfen soll, Betroffene von Menschenhandel frühzeitig zu identifizieren, zu unterstützen und ans Hilfesystem weiterzuleiten. NRMs sollen Handlungsorientierung bieten und Standards für Verfahrensabläufe definieren. Die OSZE empfiehlt allen Mitgliedstaaten, NRMs zu etablieren.
Diese Notwendigkeit wird auch durch die geänderte EU-Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz der Betroffenen betont, die die Etablierung von NRMs in den Mitgliedsstaaten vorsieht.
In Deutschland gibt es bisher keinen formalen NRM, aber im Nationalen Aktionsplan zur Prävention und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz der Betroffenen wurde das Bekenntnis zur Stärkung von Verweisungsmechanismen festgehalten.
Die Bundesregierung hat im Sommer einen Prozess zur Prüfung möglicher Verbesserungen von Verweisungsstrukturen für Betroffene von Menschenhandel und zur Erarbeitung eines Verweisungmechanismus angestoßen. Dieser soll die frühzeitige Identifizierung und gezielte Unterstützung von Betroffenen fördern.
In einem ersten Schritt wurde eine Unterarbeitsgruppe (UAG) der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Menschenhandel, bestehend aus Vertreter*innen von Bundesministerien, von Länderfachkonferenzen, des BKA und der FKS, von ECPAT, der UBSKM und der Servicestelle gegen Arbeitsausbeutung, Zwangsarbeit und Menschenhandel eingesetzt. Geleitet wurde die Gruppe von der Berichterstattungsstelle Menschenhandel am Deutschen Institut für Menschenrechte und dem KOK.
Die UAG hat in einem partizipativen Prozess zunächst ein gemeinsames Verständnis für die mit einem NRM verfolgten Aufgaben und Ziele erarbeitet und Mindeststandards zusammengetragen, die nach Ansicht der UAG bundesweit gegeben sein müssen, um einen tragfähigen NRM abzubilden.
Die Arbeitsergebnisse der Unterarbeitsgruppe sollen als Grundlage für den weiteren Prozess zur Einrichtung eines NRM in Deutschland dienen.
Um sicherzustellen, dass Betroffene von Menschenhandel in allen Bundesländern die gleichen Unterstützungsleistungen erhalten, sollte der Nationale Verweisungsmechanismus nach Ansicht der UAG-Leitung bundesweit auf einheitlichen Minimalstandards basieren.
Ältere Newsletter finden Sie im Archiv >>