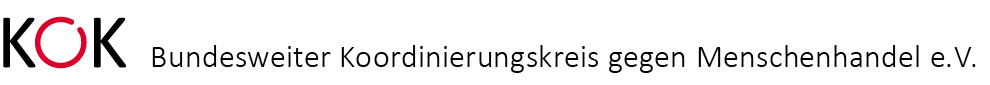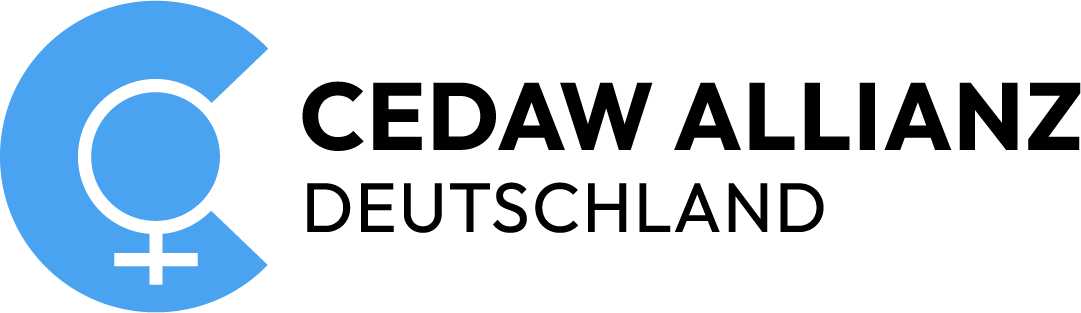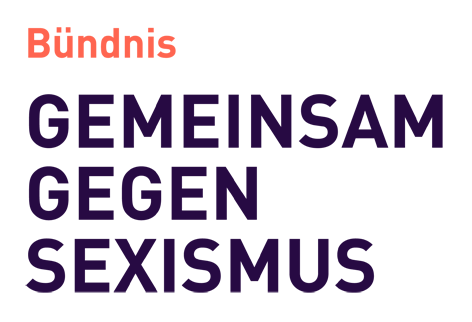Peer-Beratung
In den letzten Jahren wird der Einsatz von Peer-Beratung als eine Methode in der Sozialen Arbeit mehr und mehr angewendet. Unter Peer-Beratung (engl. peer counseling) versteht man eine Form der Beratung und Unterstützung durch Menschen, die ähnliche Erfahrungen, Hintergründe oder Probleme haben, wie die zu beratenden Personen. Diese Art der Beratung basiert auf dem Prinzip der Gleichwertigkeit und des gegenseitigen Austauschs und kann in verschiedenen Kontexten angewendet werden. Ein zentraler Aspekt in der Diskussion um Peer-Beratung ist die zunehmende Bedeutung der Selbstorganisation und Selbsthilfe unter Betroffenen unterschiedlicher Gewaltformen und psychischer Erkrankungen.
Es gibt Forschung, die die Auswirkungen von Peer-Beratung untersucht und durchaus positive Wirkungen feststellt. Um positiv zu wirken, müssten allerdings die organisatorischen Faktoren gut gehandhabt, die Projekte gut umgesetzt und begleitet werden.
Peer-Projekte
Einige Mitgliedsorganisationen des KOK binden ehemalige Klient*innen in ihre alltägliche Arbeit ein. In dem Fall sprechen wir von Peer-Projekten. Entweder unterstützen Peers die Fachberatungsstellen im direkten Kontakt mit aktuelle Klient*innen, arbeiten als Beirät*innen oder unterstützen bei der Schulungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Folgenden werden einige dieser Peer-Projekte von Fachberatungsstellen für Betroffene von Menschenhandel vorgestellt. Die Projekte integrieren aktiv Perspektiven und Erfahrungen der Betroffenen, um deren Bedarfe miteinzubeziehen und Angebote an diesen auszurichten.
Folgende Peer-Projekte, Gremien und Maßnahmen der spezialisierten Fachberatungsstellen werden derzeit angeboten:

Hydra e.V. Beratungsstelle zu Sexarbeit und Prostitution
lesenHydra Cafè
Das Hydra Café ist ein Raum von und für Sexarbeitende. Mit dem Ziel, verschiedene Sexarbeit-Communitys nachhaltig zu stärken, wird hier mit dem Peer-to-Peer Ansatz gearbeitet. Dies bedeutet, dass…

JADWIGA Fachberatungsstelle München
lesen‚Hand in Hand‘ Mentoring
Zur Unterstützung unserer Klient*innen, die besonders schutzbedürftige geflüchtete Frauen und Männer sind, da sie betroffen von Menschenhandel waren, setzen wir zusätzlich zu unseren intensiven…

Nadeschda, Frauenberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel
lesenPeer-to-Peer-Projekt/Alltagslotsinnen
Ehemalige Klientinnen (überwiegend aus Westafrika) werden zu sogenannten Alltagslotsinnen ausgebildet, um neue Klientinnen der Beratungsstelle NADESCHDA muttersprachlich zu…