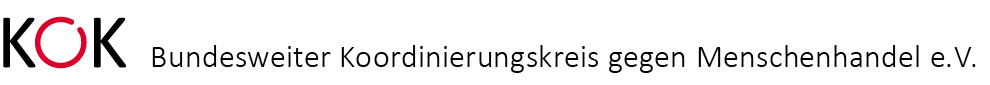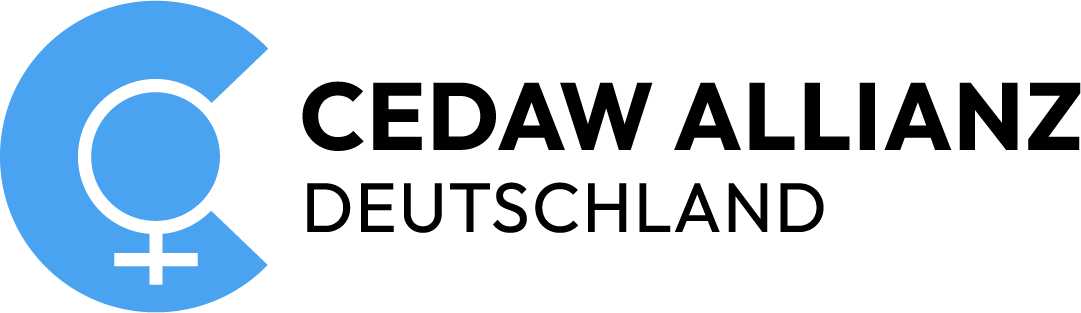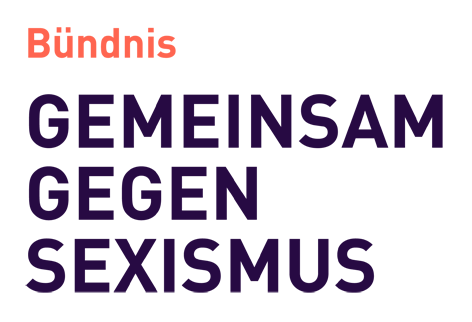BAG, Urteil vom 18.11.2015
Aktenzeichen 5 AZR 814/14
Stichpunkte
Sittenwidrige Arbeitsvergütung – Annahmeverzug – Arbeitszeitberechnung – Urlaubsanspruch
Zusammenfassung
Die Klägerin war vom 10. Februar bis zum 31. Oktober 2012 als Busbegleiterin bei der Beklagten beschäftigt. Ihre Aufgabe bestand darin, Schüler*innen mit Behinderung morgens zur Schule zu begleiten und sie nachmittags wieder nach Hause zu bringen. Ein schriftlicher Arbeitsvertrag wurde zunächst nicht geschlossen. Die Klägerin erhielt 7,50 EUR pro Tour. Zahlungen wurden nur für erbrachte Arbeit geleistet. Eine Entgeltfortzahlung für Feiertage oder bei Arbeitsunfähigkeit erhielt die Klägerin ebenso wenig wie bezahlten Erholungsurlaub. Im Juli 2012 wurde ein schriftlicher Arbeitsvertrag mit einem vereinbarten Stundenlohn von 9,00 EUR brutto geschlossen. Die Klägerin erhielt auch weiterhin weder bezahlten Urlaub noch Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Für die Zeit der Schulferien bestimmte der Arbeitsvertrag, dass entweder Urlaub zu nehmen sei oder das Arbeitsverhältnis ruhen solle. Nach der Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch die Beklagte und deren späterer gewollten Rücknahme lehnte die Klägerin eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ab und machte Ansprüche auf ausstehende Vergütung sowie Urlaubsabgeltung geltend.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied in dem Revisionsverfahren über mehrere arbeitsrechtliche Fragen: die Sittenwidrigkeit der Vergütung, die Berechnung der vergütungspflichtigen Arbeitszeit, die Voraussetzungen des Annahmeverzugs durch den Arbeitgeber und die Abgeltung von Urlaubsansprüchen.
Sittenwidrig niedrige Vergütung und Anspruch auf übliche Vergütung
Das BAG stellte fest, dass die Vergütungsabrede sittenwidrig und daher nach § 138 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) nichtig war. Eine sittenwidrige Vergütungsabrede liegt vor, wenn ein auffälliges Missverhältnis zwischen der Arbeitsleistung und der Vergütung besteht. Maßgeblich für die Feststellung des Missverhältnisses ist der Vergleich mit dem einschlägigen Tarifvertrag oder, falls kein Tarifvertrag existiert, mit der üblichen Vergütung gemäß § 612 Abs. 2 BGB. Liegt der vereinbarte Lohn um mehr als ein Drittel unter dem tariflichen oder ortsüblichen Lohnniveau, liegt laut BAG eine ganz erhebliche und regelmäßig nicht mehr hinnehmbare Unterschreitung eines angemessenen Lohnes vor, für dessen Rechtmäßigkeit es einer spezifischen Rechtfertigung bedarf. Eine sittenwidrige Vergütung setzt zudem voraus, dass der Arbeitgeber die Zwangslage oder Unerfahrenheit der Arbeitnehmer*innen bewusst ausnutzt. Ist der Wert der Arbeitsleistung mindestens doppelt so hoch wie der Wert des dafür gezahlten Lohnes, wird eine solche verwerfliche Gesinnung des Arbeitgebers vermutet.
Seit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) im Jahr 2015 ist die Feststellung der Sittenwidrigkeit bei niedrigen Löhnen seltener ein juristisches Problem. Dennoch bleibt die Rechtsprechung des BAG relevant, da der Mindestlohn nicht in allen Fällen eine sittenwidrige Vergütung ausschließt. In Branchen mit allgemeinverbindlichen Tarifverträgen oder bei überlangen Arbeitszeiten kann ein Lohn etwa trotz Einhaltung des Mindestlohns sittenwidrig sein. Auch in dem vorliegenden Fall ergab sich das Missverhältnis zwischen geleisteter Arbeit und Vergütung daraus, dass ein relevanter Teil der von der Klägerin aufgewandten Zeit von der Arbeitgeberin nicht als Arbeitszeit gewertet wurde.
Berechnung der Arbeitszeit und vergütungspflichtige Zeiten
Das BAG führte aus, dass gemäß § 611 Abs. 1 BGB nicht nur die eigentliche Begleitung der Schüler*innen als Arbeitszeit anzusehen ist, sondern auch die Zeiten, in denen sich die Klägerin aufgrund der betrieblichen Organisation an einem bestimmten Ort aufhalten musste. Entgegen der Auffassung der beklagten Arbeitgeberin zählten damit ebenso Leerfahrten ohne Schüler*innen, Standzeiten des Busses an der Schule und andere Wartezeiten, während denen die Klägerin arbeitsbereit bleiben mussten, zur Arbeitszeit. Das BAG stellte klar, dass jede Zeit, in der die Klägerin nicht frei über ihre Zeit verfügen konnte, als Arbeitszeit gilt.
Annahmeverzug und Lohnfortzahlung während der Schulferien
Das BAG verneinte jedoch den Lohnanspruch der Klägerin für die Zeit der Schulferien, in denen sie tatsächlich nicht gearbeitet hatte. Insbesondere sah das BAG keinen Anspruch aufgrund eines Annahmeverzugs bezüglich der Arbeitsleistung der Klägerin durch die Arbeitgeberin nach § 615 BGB. Demnach bleibt der Lohnanspruch auch ohne erbrachte Arbeitsleistung bestehen, wenn der Arbeitnehmer die Leistung tatsächlich anbietet, der Arbeitgeber die Leistung jedoch trotz Pflicht zur Entgegennahme nicht annimmt. Ein tatsächliches Arbeitsangebot hatte die Klägerin nicht abgegeben. Das BAG sah vorliegend auch keine Ausnahmesituation, in der das Angebot entbehrlich war. Eine solche liegt etwa vor, wenn der Arbeitgeber offenkundig die Annahme verweigern wird. Im vorliegenden Fall hätte die Klägerin stattdessen gegen den Nichteinsatz während der Ferien protestieren und ihre Arbeit jedenfalls mündlich anbieten müssen.
Urlaubsabgeltung
Das BAG entschied zudem, dass die Klägerin Anspruch auf Urlaubsabgeltung für zehn Tage hatte, da ihr kein bezahlter Erholungsurlaub gewährt wurde. Die Beklagte konnte sich nicht darauf berufen, dass das Arbeitsverhältnis während der Schulferien ruhte, da eine solche Regelung nach § 307 Abs. 1 S. 2 BGB intransparent und daher unwirksam sei. Insbesondere sei unklar, an welchen Tagen Urlaub genommen werden und an welchen Tagen das Arbeitsverhältnis ruhen solle. Der Anspruch ergibt sich vorliegend aus § 7 Abs. 4 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG), wonach der Urlaubsanspruch abzugelten ist, wenn er wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr gewährt werden kann.
Entscheidung im Volltext: