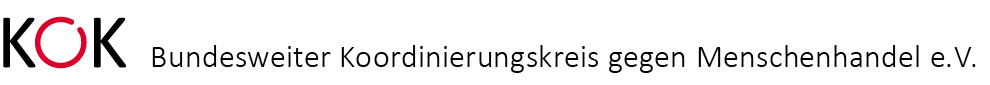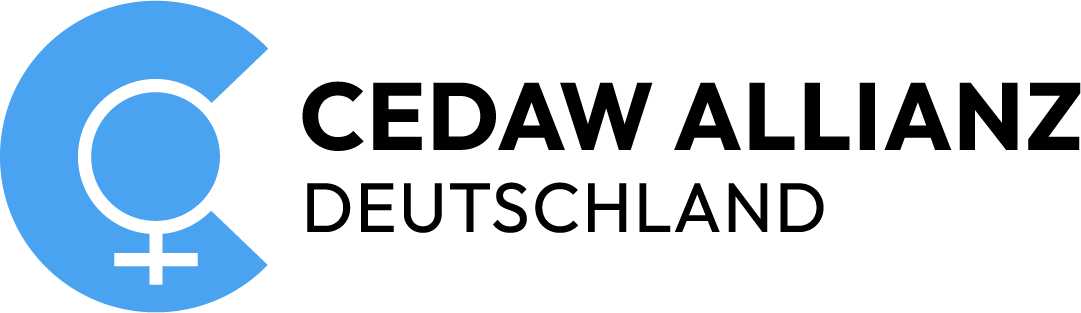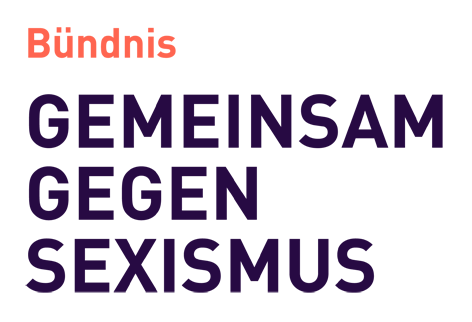Der KOK Newsletter erscheint vier Mal im Jahr. Wenn Sie die neuesten Informationen des KOK erhalten möchten, können Sie unseren Newsletter abonnieren. Das Abonnement kann jederzeit wieder abbestellt werden.
Ältere Newsletter finden Sie im Archiv >>
NEUIGKEITEN
Einschätzung des KOK zu den Nationalen Aktionsplänen Menschenhandel
Der Nationale Aktionsplan zur Prävention und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz der Betroffenen (NAP MH) wurde im Dezember von der Bundesregierung beschlossen und dem Parlament vorgestellt. Zusätzlich wurde im Februar 2025, ebenfalls von der Bundesregierung, der Nationale Aktionsplan gegen Arbeitsausbeutung und Zwangsarbeit (NAP AZ) beschlossen.
Zu beiden NAPs fanden während der Erarbeitung Beteiligungsprozesse statt, in die sich auch der KOK mit Eingaben aktiv einbrachte.
In einer Stellungnahme hat der KOK nun eine Einschätzung der Maßnahmen in den einzelnen Handlungsfeldern vorgenommen.
Der NAP MH leistet vor allem eine Gesamtschau von Maßnahmen, die zur Erfüllung der internationalen Vorgaben gemacht werden. Er ist ein wichtiger Schritt der Bundesregierung, um den Schutz der Betroffenen und die Bekämpfung des Menschenhandels nachhaltig zu stärken. Der KOK begrüßt ausdrücklich, dass mit dem NAP MH und dem NAP AZ umfassende Abstimmungsprozesse zwischen den Ressorts initiiert wurden, die eine wichtige Grundlage für ein transparentes und einheitliches Vorgehen bieten. Das Kompilieren der bestehenden und geplanten Maßnahmen ist bereits ein bedeutender Beitrag zur Politikfeldbeschreibung und zur Koordination der vielfältigen Akteure.
Besonders positiv fällt auf, dass der KOK und andere zivilgesellschaftliche Akteure explizit mit Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Rahmen der NAP betraut werden. Die gemeinsamen Vernetzungstreffen, die Etablierung einer Online-Beratungsplattform für Betroffene, die Erhebung zivilgesellschaftlicher Daten sowie die Sensibilisierung von Mitarbeitenden der Versorgungsämter, wie sie im NAP MH benannt sind, sind wichtige Schritte, die unsere Expertise und das Engagement des KOK widerspiegeln. Der KOK versteht sich als aktiver Partner im Umsetzungsprozess und ist bereit, mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk einen substanziellen Beitrag zu leisten.
Insgesamt bieten die beiden Aktionspläne eine vielversprechende Grundlage für eine effektive Bekämpfung des Menschenhandels und den Schutz der Betroffenen.
Ein zentrales Problem bleibt jedoch die unsichere finanzielle Ausstattung vieler Maßnahmen. Ohne zusätzliche Mittel ist eine erfolgreiche Umsetzung gefährdet.
UEFA Women’s EURO 2025 – Kampagne gegen Menschenhandel gestartet
Anlässlich der UEFA Women’s EURO 2025 hat die Initiative „It’s a Penalty“ am 25.06. eine europaweite Aufklärungskampagne gegen Menschenhandel gestartet. Gemeinsam mit internationalen Fußballstars, Reiseunternehmen und NGOs sollen mit der Kampagne Menschen in der Schweiz und darüber hinaus erreicht werden. Ziel ist es, die Öffentlichkeit für die Anzeichen von Ausbeutung zu sensibilisieren und zum Handeln zu befähigen. Zu den Partnern gehören u.a. die außerordentliche KOK Mitgliedsorganisation FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration und das europäische Anti-Menschenhandelsnetzwerk La Strada International, in dem der KOK Mitglied ist.
Neue Fachstelle Identifizierung besonderer Schutzbedarfe
Seit Ende Mai gibt es die Bundesweite Zivilgesellschaftliche Fachstelle Identifizierung und Umsetzung besonderer Schutzbedarfe in Berlin. Ihre Aufgabe ist es, Voraussetzungen für die systematische Identifizierung und die Umsetzung besonderer Schutzbedarfe zu verbessern und Fachkräfte aus Zivilgesellschaft, Behörden und Ministerien diesbezüglich zu unterstützen und zu vernetzen. Auf der zugehörigen Website können sich Fachkräfte und Interessierte zu rechtlichen und praktischen Grundlagen, weiterführenden Materialien sowie Fortbildungs- und Vernetzungsmöglichkeiten informieren.
Evaluierung des Prostituiertenschutzgesetzes
Das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) hat dem Bundestag am 24.06. den umfassenden Bericht des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) zur Evaluation des Prostituiertenschutzgesetzes vorgelegt.
Der KOK begrüßt die umfassende, gründliche und ausgewogene Evaluation des Prostituiertenschutzgesetzes. Dass neben einer Vielzahl von Akteuren auch zahlreiche Sexarbeiter*innen selbst dafür angehört wurden und ihre Perspektiven einbringen konnten, ist positiv zu bewerten. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Erhellung des Dunkelfelds geleistet. Die Erkenntnisse sind differenziert und heterogen. Sie sind Grundlage für eine Vielzahl praktischer und gesetzgeberischer Empfehlungen, die nach Einschätzung der Verfasser*innen u.a. die Rahmenbedingungen des Anmeldeverfahrens, aber auch die sozial- und arbeitsrechtliche Situation für Sexarbeiter*innen maßgeblich verbessern können.
Mit der im ProstSchG vorgesehenen Beratung im Kontext des verbindlichen Anmeldeverfahrens könne es nachweislich gelingen, Betroffene von Menschenhandel zu identifizieren, sofern das Personal entsprechend geschult ist. Allerdings gebe es auch hier einigen Nachbesserungsbedarf. Laut Evaluierung halten datenschutzrechtliche Bedenken sowie Angst vor Stigmatisierung und Benachteiligung Personen von der Anmeldung ab.
Die Autor*innen sehen Anhaltspunkte dafür, dass die u. a. im Gesetzgebungsverfahren auch von Beratungsstellen geäußerte Befürchtung, Kleinstbetriebe könnten vom Markt gedrängt werden, zutrifft, obgleich gerade solche Kleinstbetriebe Frauen Sicherheit bieten könnten.
Eine weitere Erkenntnis der Evaluierung ist, dass das Ausfindigmachen nicht offiziell angemeldeter Betriebe teils schwer falle.
In der Evaluation stellen die Autor*innen zudem fest, dass die mediale Diskussion über Sexarbeit und die Regulierung von Prostitution stark durch kriminalitätsbezogene Narrative geprägt sei und eine differenzierte Auseinandersetzung mit Prostitution als Erwerbstätigkeit und den Lebensrealitäten der betroffenen Personen zu wenig stattfinde.
In einem zusätzlichen, ergänzenden Rechtsgutachten wird untersucht, wie Prostitution mit dem rechtlichen Konzept der Freiwilligkeit in Einklang steht. Laut Gutachten ist Prostitution eine grundgesetzlich geschützte Tätigkeit sei und dass der Staat gegenüber jenen, die sie freiwillig ausüben, eine Schutzpflicht habe. Das Gutachten unterstreicht, dass die freiwillig ausgeübte Prostitution von Zwang und Menschenhandel klar zu unterscheiden sei.
Die Deutsche Aidshilfe hat sich in einer Pressemitteilung mit dem Evaluierungsbericht auseinandergesetzt und sieht in den Ergebnissen eine Grundlage zur Weiterentwicklung der Gesetzeslage.
Position des Paritätischen Gesamtverbands zum Schutz von Sexarbeiter*innen
Am 25.04. hat der Paritätische Gesamtverband eine Position zum Schutz von Sexarbeiter*innen verabschiedet. Mit diesem Positionspapier bringt sich der Verband aktiv in die aktuelle Debatte um die Überprüfung des Prostituiertenschutzgesetzes ein. Das Dokument fasst zentrale Perspektiven und Diskussionen innerhalb des Verbands zusammen. Im Verband besteht Einigkeit darüber, dass ein generelles Sexkaufverbot kritisch zu bewerten ist und dass die menschenrechtliche Absicherung sowie der Schutz von Personen in der Sexarbeit gestärkt werden müssen.
GRETA Jahresbericht 2024
Die Expert*innengruppe des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels (GRETA) fordert in ihrem Jahresbericht für 2024 entschlossenes politisches Handeln angesichts der wachsenden Herausforderungen im Einsatz gegen Menschenhandel. Eine restriktive Einwanderungspolitik, unzureichende legale Wege für die Migration und Hindernisse beim Zugang zum Arbeitsmarkt verschärften das Risiko der Ausbeutung, insbesondere für Asylsuchende und Vertriebene. Der Schutz der Betroffenen müsse europaweit dringend verbessert werden. Der Bericht hebt drei zentrale Problembereiche hervor: die Ausbeutung von Minderjährigen, Arbeitsausbeutung und den zunehmenden Einsatz digitaler Technologien durch Täter*innen. GRETA fordert, Kinderschutzsysteme zu stärken und Maßnahmen gegen Menschenhandel konsequent in humanitäre Schutzmechanismen zu integrieren. Zudem bräuchte es gezielte Investitionen in digitale Kompetenzen, moderne Technik und spezialisierte Schulungen für Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden.
Grundrechte in Europa stehen unter Druck
Der Grundrechte-Bericht 2025 der EU-Agentur für Grundrechte (FRA) macht deutlich, dass die Bedrohung demokratischer Prozesse durch Desinformation, Falschinformationen und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz wächst und freie und faire Wahlen gefährden kann. Gleichzeitig bleiben Gewalt gegen Frauen und digitale Gewalt weit verbreitete Probleme. Rassismus, Diskriminierung und Hassrede, besonders im Internet, betreffen weiterhin insbesondere Minderheiten wie muslimische, jüdische, Schwarze sowie LGBTIQ-Personen. Die FRA fordert von der EU und ihren Mitgliedstaaten entschlossenes Handeln, um faire und sichere Wahlen zu garantieren, Gewalt gegen Frauen wirksam zu bekämpfen, alle Formen von Rassismus und Diskriminierung zu adressieren, Menschenrechte an den Grenzen zu wahren und digitale Technologien grundrechtskonform zu regulieren.
20 Jahre Europaratskonvention gegen Menschenhandel
Vor 20 Jahren, am 16.05.2005, wurde das Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels von den Vertragsstaaten unterzeichnet – ein Meilenstein für die menschenrechtliche Verankerung des Themas in Europa. Der KOK wies anlässlich dieses Jubiläums auf anhaltende Defizite in der Umsetzung hin und forderte die Bundesregierung zum Handeln auf. „Viele Betroffene von Menschenhandel können ihre in der Konvention benannten Rechte in der Praxis in Deutschland nicht wahrnehmen – sei es wegen fehlender Informationen, bürokratischer Hürden oder mangelnder struktureller Voraussetzungen“, sagt Sophia Wirsching, Geschäftsführerin des KOK. „Besonders in Anbetracht aktueller migrationspolitischer Entwicklungen braucht es dringend Fortschritte, um Betroffene ohne deutsche Staatsbürgerschaft zu schützen.“
Der KOK fordert im Einklang mit der Konvention seit Langem die Schaffung eines vom Strafverfahren unabhängigen Aufenthaltstitels für Betroffene von Menschenhandel.
Das Deutsche Institut für Menschenrechte nutzte den Anlass ebenfalls, um die Bundesregierung aufzufordern, die Umsetzung der Europaratskonvention gegen Menschenhandel in Deutschland konsequent voranzubringen. Besonders für von Menschenhandel betroffene Kinder und Jugendliche fehlten weiterhin spezialisierte Schutzunterkünfte und geeignete Maßnahmen zur Identifizierung und Unterstützung.
Neue EU-Plattform für Forschung, Analyse und Beratung im europaweiten Einsatz gegen Menschenhandel
Am 05.06. wurde im Rahmen des EU-Netzwerks der Nationalen Koordinator*innen und Berichterstatter*innen gegen Menschenhandel in Brüssel offiziell ein sogenannter EU Anti-Trafficking Hub eröffnet. Die Plattform bringt Expertise aus unterschiedlichen Bereichen zusammen, um den gemeinsamen Einsatz gegen Menschenhandel in der EU zu stärken.
Die Plattform dient der Zusammenarbeit nationaler Behörden, zivilgesellschaftlicher Organisationen – darunter das europäische Netzwerk La Strada International, in dem der KOK Mitglied ist, EU-Agenturen sowie weiteren relevanten Akteuren. Sie unterstützt die Umsetzung der EU-Strategie gegen Menschenhandel.
Ziel des Anti Trafficking Hub ist es, durch Forschung, Analyse und Beratung Impulse für politische Maßnahmen und praktische Ansätze zu geben.
Inhaltliche Schwerpunkte sind zunächst:
- Unterstützung bei der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels
- Arbeitsausbeutung
- die Rolle nationaler Koordinator*innen und Berichterstatter*innen
- die Weiterentwicklung nationaler Verweisungsmechanismen sowie
- die Verbesserung der Datenerhebung
Weltflüchtlingstag
Zum Weltflüchtlingstag am 20.06. machte KOK in einer Meldung auf die kritische Situation geflüchteter Betroffener von Menschenhandel aufmerksam. Anstatt Schutz und Unterstützung zu erhalten, sind viele von ihnen zunehmend von Kriminalisierung und Schutzlosigkeit betroffen. Betroffene von Menschenhandel haben das Recht auf effektiven Schutz, rechtliche Sicherheit und Zugang zu Unterstützung. Der KOK unterstützt daher auch den Appell des Zentrum ÜBERLEBEN, dem Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige geflüchtete Menschen (BNS) und weiteren Organisationen zum Weltflüchtlingstag, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, allen Schutzsuchenden in Deutschland den Zugang zum Gesundheitssystem zu gewährleisten.
Laut einer Umfrage des Bundesfachverbands Minderjährigkeit und Flucht (BuMF) von 2024 verschlechtert sich die Lage junger Geflüchteter in Deutschland: Gewalt, Rassismus und Zugangsbeschränkungen nehmen zu. Fachkräfte erleben das Asylsystem als zunehmend restriktiv, was sich negativ auf die psychische Gesundheit junger Menschen auswirke. Politische Maßnahmen wie die GEAS-Reform verschärften die Situation zusätzlich.
Neue Taskforce Europol
Europol hat eine neue operative Taskforce (OTF) ins Leben gerufen, um gegen den zunehmenden Trend von „Gewalt als Dienstleistung“ und die damit häufig verbundene Rekrutierung junger Täter*innen für die schwere und organisierte Kriminalität vorzugehen. Unter der Bezeichnung OTF GRIMM vereint die von Schweden geleitete Taskforce Strafverfolgungsbehörden aus Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Norwegen, wobei Europol operative Unterstützung, Bedrohungsanalysen und Koordination leistet.
Die Ausnutzung junger Täter*innen für kriminelle Handlungen hat sich als eine sich schnell verbreitende Taktik des organisierten Verbrechens erwiesen. Dieser Trend wurde in der EU-Bewertung der Bedrohungslage im Bereich der Schwerkriminalität und der organisierten Kriminalität 2025 (EU-SOCTA) hervorgehoben. Demnach werden Jugendliche gezielt als Mittel zur Vermeidung von Strafverfolgung eingesetzt.
Mögliche Tatbestände sind Drogenhandel, Cyberangriffe, Online-Betrug und gewalttätige Erpressung. Die Taskforce strebt nun unter anderem die Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen an.
Europol hat zudem einen Sensibilisierungsleitfaden für Eltern und Angehörige mit einer Liste von Warnzeichen zusammengestellt.
RUBRIK WISSEN – GEWALTHILFEGESETZ
Das im Februar dieses Jahres vom Bundesrat verabschiedete Gesetz hat zum Ziel, bundesweit einen kostenfreien und niedrigschwelligen Zugang zu Schutz- und Beratungseinrichtungen für Frauen und deren Kinder sicher zu stellen. Gewaltbetroffene sollen ab 2032 einen individuellen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung beikommen.
Das neue Gewalthilfegesetz schafft erstmals eine verbindliche Grundlage für Hilfen bei geschlechtsspezifischer Gewalt und setzt zentrale Vorgaben der Istanbul-Konvention um.
Zielgruppe des Gesetzes sind Frauen, die von häuslicher oder geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind. Der Rechtsanspruch gilt also auch für weibliche Betroffene von Menschenhandel (zumindest von sexueller Ausbeutung). Das Gesetz benennt neben Frauenhäusern auch Fachberatungsstellen als Einrichtungen im Sinne des Gesetzes. Eine Grundlage ist, dass sie durch einen (nach § 7) anerkannten Träger betrieben werden oder einem solchen angeschlossen sind. Der Mitgliedschaft eines Trägers bei einem anerkannten Verband der freien Wohlfahrtspflege oder der Förderung des Trägers durch einen anerkannten Verband der freien Wohlfahrtspflege sollen im Anerkennungsverfahren Rechnung getragen werden. Die Mitgliedschaft eines Trägers in einem Fachverband ist angemessen zu berücksichtigen. Als ein solcher Fachverband ist in der Gesetzesbegründung auch explizit der KOK benannt.
Die Bundesländer werden verpflichtet, Bestandsanalysen und Entwicklungsplanungen durchzuführen, um den Bedarf zu ermitteln und entsprechend Schutzplätze zu schaffen.
Im Gesetz heißt es dazu (in § 8 Ausgangsanalyse und Entwicklungsplanung):
„(1) Die Länder ermitteln den Bestand von Schutz- und Beratungskapazitäten einschließlich deren Versorgungsdichte. Sie führen eine Analyse zur Bestimmung der erforderlichen Schutz- und Beratungskapazitäten durch, planen darauf aufbauend die notwendige Entwicklung eines Netzes an Schutz- und Beratungsangeboten mit Darstellung der zeitlichen Abfolge sowie weiterer Maßnahmen zur Aufgabenerfüllung nach § 1 Absatz 2 und stellen ein Finanzierungskonzept auf.
(2) Die Analyse zur Bestimmung der erforderlichen Schutz- und Beratungskapazitäten richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf an bedarfsgerechten und niedrigschwelligen Schutz- und Beratungsangeboten in ausreichender Zahl und angemessener geografischer Verteilung. Sie berücksichtigt regionale Strukturen.“
Die Analysen und Entwicklungsplanungen starten bereits, sie sollen bis zu einem durch das Bundesland festgelegten Stichtag (aber vor 2027) abgeschlossen sein. Die Analyse und Finanzierungsplanung soll dann alle fünf Jahre stattfinden.
Der Bund beteiligt sich mit 2,6 Milliarden an den Kosten, die Umsetzung liegt bei den Bundesländern.
Die Frauenhauskoordinierung stellt ein kompaktes Fact Sheet zu Gesetzesinhalten, Anspruchsberechtigten und Tatbestandsvoraussetzungen bereit – darüber hinaus ergänzt sie das Angebot durch eine umfassende FAQ-Seite.

Jetzt ganz einfach für den KOK spenden:
- per Überweisung auf unser Spendenkonto: Evangelische Bank eG, IBAN: DE43 5206 0410 0003 9110 47, BIC: GENODEF1EK1
- mit jedem Einkauf automatisch spenden über wecanhelp.de
- über das Spendenformular auf unserer Webseite
VERÖFFENTLICHUNGEN DES KOK
Pressemitteilung zu 20 Jahren Europaratskonvention gegen Menschenhandel
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Inkrafttretens der Europaratskonvention zur Bekämpfung des Menschenhandels am 16.05. veröffentlichte der KOK eine Pressemitteilung. (siehe auch unter Neuigkeiten in diesem Newsletter).
Nationale Aktionspläne Menschenhandel – Einschätzung des KOK
Am 24.06. hat der KOK seine Einschätzung des Prozesses und der geplanten Maßnahmen sowohl des Nationalen Aktionsplans zur Prävention und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz der Betroffenen (NAP MH) als auch des Nationalen Aktionsplans gegen Arbeitsausbeutung und Zwangsarbeit (NAP AZ) veröffentlicht (siehe auch unter Neuigkeiten in diesem Newsletter).
KOK-VERANSTALTUNGEN
KOK-Fortbildungs- und Vernetzungstreffen 2025 in Berlin
Das diesjährige KOK-Fortbildungs- und Vernetzungstreffen fand am 02. und 03.06. in Berlin statt. Im Fokus des Treffens standen die Wissensweitergabe und das Voneinander-Lernen angesichts vieler neuer Kolleg*innen in den Fachberatungsstellen. Die spezialisierten Fachberatungsstellen für Betroffene von Menschenhandel arbeiten nach gemeinsam entwickelten und in einem Qualitätshandbuch festgehaltenen Leitprinzipien und Standards, die kontinuierlich mit den Praxisbedarfen abgeglichen und fortentwickelt werden. Dies war Grundlage der Wissens- und Erfahrungsweitergabe unter den Kolleg*innen. In Arbeitsgruppen besprachen die Teilnehmer*innen Best-Practices zu den Themen Erstgespräche, Kooperation mit den Behörden und Fallübergabe zwischen den Fachberatungsstellen. Weiterer Schwerunkt was das Thema Vernetzung mit Akteuren der Wohnungslosenhilfe und thematische Überschneidungen in der Beratung.
KOK im Gespräch
Die Veranstaltungsreihe „KOK im Gespräch“ ist ein neuer Service für die KOK-Mitgliedsorganisationen. Alle zwei Monate bietet der KOK mit der Veranstaltung die Möglichkeit zur fachlichen Weiterbildung und zum Austausch zu relevanten und aktuellen rechtlichen Themen. Bisher fanden Veranstaltungen zu den Themen sozialrechtliches Verfahren, Geltendmachung von Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüchen vor den Zivil- und Strafgerichten mit Schwerpunkt Prozesskostenhilfe und Adhäsionsverfahren sowie zu vorläufigen Leistungen nach dem SGB XIV statt.
VERANSTALTUNGEN
Dreitägige Fortbildung zum Thema „Professionelle Opferhilfe“
Der Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V. (ado) bietet Anfang Februar 2026 eine dreitägige Fortbildung zum Thema „Professionelle Opferhilfe“ an. Die Fortbildung richtet sich an Fachkräfte, die mit Betroffene von Straf- und Gewalttaten arbeiten oder zukünftig arbeiten werden. Ziel ist es, Kenntnisse und Methoden für einen einfühlsamen und fachlich fundierten Umgang mit Betroffenen zu vermitteln.
Die Teilnahmegebühr beträgt 350 Euro (inklusive Mittagessen und Tagungsgetränken). Weitere Informationen finden Sie im Flyer und Anmeldeformular.
Save the Date: Nürnberger Tage für Migration
Jährlich lädt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Fachleute aus Verwaltung, Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft zu den „Nürnberger Tagen für Migration“ ein. In diesem Jahr findet die Tagung am 11. und 12.11. statt und steht unter dem Leitthema „Asyl- und Integrationspolitik im Umbruch – Vor welchen Herausforderungen stehen wir?“. Eine Teilnahme ist sowohl in Präsenz als auch virtuell im Rahmen des Hauptprogramms möglich.
30. Deutscher Präventionstag in Augsburg
Am 23. und 24.06. fand in Augsburg der 30. Deutsche Präventionstag unter dem Motto „Prävention und gesellschaftlicher Frieden“ statt. Gemeinsam mit der Fachberatungsstelle Jadwiga war der KOK mit einem Infostand vor Ort und stellte seine Arbeit sowie die seiner Mitgliedsorganisationen vor.
Im Fokus standen Aufklärung, fachlicher Austausch. Besucher*innen erhielten Einblicke in aktuelle Entwicklungen – vom neuen Nationalen Aktionsplan gegen Menschenhandel bis zur bayernweiten Kampagne „Gemeinsam gegen Loverboys“ von JADWIGA. Fachkräfte konnten sich zudem mit vielfältigem Informationsmaterial versorgen.
Bereits am 21.06. fand ein öffentlicher Aktionstag für alle Augsburger*innen statt. Auch hier war JADWIGA präsent, stellte seine Arbeit vor und bot einen Workshop zur Loverboy-Methode an.
Erstes UN Global Forum for Human Trafficking Survivors
Dr. Adina Schwartz, Vorstandsfrau des KOK und Leiterin der Beratungsstelle Jadwiga nahm am ersten Global Forum for Human Trafficking Survivors, organisiert von UN-Büro für Drogen und Verbrechensbekämpfung, UNODC, teil. Das Forum, das am 24. und 25.06. in Wien stattfand, machte deutlich, dass Betroffene von Menschenhandel starke Stimmen, Führungspersönlichkeiten und Gestalter*innen des Wandels sein können. In einem auf der Konferenz verabschiedeten Call for Action werden Regierungen aufgefordert, ihre Schutzmaßnahmen auf neun grundlegende Prinzipien zu stützen, die die Auswirkungen von Traumata anerkennen und die von den Erfahrungen und Erkenntnissen der Betroffenen aktiv in politisches Handeln gegen Menschenhandel einbinden.
RECHTLICHE ENTWICKLUNGEN
Entscheidung des EuGH zur Beihilfe zur Unerlaubten Einreise
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dass es keine Straftat darstellt, minderjährigen Schutzsuchenden bei der Einreise in die EU zu helfen, wenn dies ihrem Wohl dient und die Familieneinheit wahrt. Solche Handlungen gelten nicht als „Beihilfe zur unerlaubten Einreise“, da sie durch die EU-Grundrechtecharta geschützt sind, insbesondere durch das Asylrecht (Artikel 18 GRC), das Recht auf Achtung des Familienlebens (Artikel 7 GRC) und Rechte des Kindes (Artikel 24 GRC). Dieses Urteil stärkt die Forderung nach klaren humanitären Ausnahmen im EU-Recht, die einer Kriminalisierung solidarischen Handelns entgegen stehen. Angesichts der Verhandlungen des EU-Parlaments über das sogenannte EU Facilitators Package, einem Gesetzesrahmen zur Bekämpfung von Schleusung ergeht das Urteil zu einem wichtigen Zeitpunkt.
Eilentscheidung von Zurückweisungen von Asylsuchenden
Das Verwaltungsgericht (VG) Berlin erklärt in einer Eilentscheidung am 02.06. auf Antrag einer somalischen Frau, die an der Grenze zu Polen von der Bundespolizei zurückgewiesen worden war, obwohl sie ein Asylgesuch geäußert hatte, die Frau habe nach der Dublin-Verordnung einen Anspruch auf Durchführung des Dublin-Verfahrens in Deutschland, allerdings keinen Einreiseanspruch soweit das Verfahren auch an der Grenze durchgeführt werden könnte. Die Zurückweisung verstoße gegen die Dublin-Verordnung. Anhaltspunkte für eine Notlage in Deutschland seien weder vorgetragen noch ersichtlich. Das Gericht sieht für die Antragstellerin auch im Hauptverfahren hohe Erfolgschancen. Die Klage wurde vom Rechtshilfefonds von Pro Asyl unterstützt. Die Organisation sieht sich nun, nach der Entscheidung des VG Berlin, Anschuldigungen ausgesetzt, bspw. von CDU und CSU Abgeordneten, die laut Medienberichten über eine Unterstützung der Somalier*innen durch Helfer*innen aus Deutschland bereits vor der Einreise und eine „(…) Inszenierung durch Asyl-Aktivisten“ spekulierten oder Pro Asyl sogar konkret vorsätzliche Unterstützung bei illegalen Grenzübertritten vorwarfen und der Begehung weiterer Straftaten begangen verdächtigten.
Aussetzung des Familiennachzugs
Der Innenausschuss hat am 25.06. die geplante zweijährige Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten gebilligt. CDU/CSU, SPD und AfD stimmten dem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zu, Grüne und Linke lehnten ihn ab. Ziel ist laut Vorlage, Aufnahme- und Integrationssysteme zu entlasten. Härtefälle sollen weiterhin berücksichtigt werden. Während sich, im Rahmen einer Sachverständigenanhörung im Innenausschuss des Bundestages am 23.06., Kommunalvertreter für die Regelung zur Entlastung von Städten aussprachen, kritisierten Wohlfahrtsverbände und Menschenrechtsorganisationen die Aussetzung als Verstoß gegen das Recht auf Familienleben und als unzureichend im Umgang mit Härtefällen. Am 27.06. stimmte auch der Bundestag dafür, den Familiennachzug für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus vorübergehend auszusetzen. Der KOK und weitere Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Einschränkung, die Frauen und Kinder besonders gefährdet. Der KOK hat bereits im Mai einen Appell unterzeichnet, der den Erhalt und die Verbesserung des Familiennachzugs fordert – aus menschenrechtlicher und integrationspolitischer Verantwortung. Viele Betroffene Familienmitglieder warten schon seit Jahren auf Nachzugsmöglichkeiten und sehen sich in der Zeit humanitären Härten ausgesetzt.
EU-Staaten wollen Lieferkettengesetz deutlich abschwächen
Die geplante EU-Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, die Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards entlang ihrer gesamten Lieferkette verpflichten sollte, wurde im EU-Ministerrat deutlich abgeschwächt. Auf Druck mehrerer Mitgliedstaaten, insbesondere mit Unterstützung der deutschen Bundesregierung, sollen die Schwellenwerte für durch die Richtlinie verpflichtete Unternehmen von 1000 auf 5.000 Beschäftigte und von 450.000 auf 1,5 Milliarden Euro Umsatz angehoben werden. Auch die ursprünglich vorgesehene zivilrechtliche Haftung soll entfallen, was Klagen bei Menschenrechtsverstößen erheblich erschwert. Zudem soll die Richtlinie nur noch für direkte Zulieferer gelten – und nicht mehr für die gesamte Lieferkette. Eine Verabschiedung durch das Europäische Parlament wird im Herbst erwartet.
INFORMATIONSMATERIAL UND PUBLIKATIONEN
Indikatoren zur Identifizierung von Betroffenen von Menschenhandel
Ein Bericht des Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) der OSCE mit dem Titel Survivor-Informed Indicators for the Identification of Victims and Survivors of Trafficking in Human Beings stellt Indikatoren zur Identifizierung von Betroffenen des Menschenhandels zusammen, die unter wesentlicher Mitwirkung von Betroffenen selbst entwickelt wurden. Die Indikatoren werden in acht Hauptkategorien aufgeführt, darunter allgemeine Anzeichen sowie spezifische Indikatoren für verschiedene Formen der Ausbeutung, einschließlich Kinderhandel, und geht auch auf aktuelle Entwicklungen, wie technologiegestützter Menschenhandel ein. Im Text wird die Relevanz dieser Indikatoren für die vorläufige Identifizierung von Betroffenen durch verschiedene Akteur*innen, die mit potenziellen Betroffenen in Kontakt kommen könnten, beschrieben.
FIZ-Studie: „Das ideale Opfer“
Die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) aus Zürich, außerordentliche Mitgliedsorganisation des KOK, hat die Studie „Das ideale Opfer. Der Einfluss von Opferbildern in der Bekämpfung von Menschenhandel“ veröffentlicht. Sie stützt sich auf die Analyse von Medienberichten, Fachliteratur sowie Interviews mit Expert*innen und ehemaligen Klientinnen. Die Analyse zeigt, dass in Öffentlichkeit und Medien enge, stereotype Vorstellungen davon, wie ein „ideales Opfer“ von Menschenhandel auszusehen hat, überwiegen. In der Praxis zeigt sich ein differenzierteres Bild. Die Studie macht deutlich, dass bessere Indikatoren zur Identifizierung von Betroffenen allein nicht ausreichen, um ihnen besseren Zugang zu Schutz und Rechten zu ermöglichen. Notwendig ist eine kritische Auseinandersetzung mit normativen Bildern und eine Praxis, die strukturelle Machtverhältnisse reflektiert und Betroffene jenseits stereotyper Vorstellungen ernst nimmt.
Studie zur Einbeziehung von Betroffenen des Menschenhandels in der Lobbyarbeit
Die serbische Anti-Menschenhandels-NGO ASTRA hat eine Publikation zur Einbeziehung von Betroffenen in die Lobbyarbeit mit dem Titel „(mis)use of human trafficking victims‘ experiences in advocacy processes“ veröffentlicht. Darin gehen die Autorinnen der Frage nach, wann und wie Betroffene in Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels einbezogen werden können und sollten. In Zusammenarbeit mit einer Therapeutin untersuchten die Autorinnen, wie ehemalige Betroffene des Menschenhandels die Beteiligung an Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels erleben und inwiefern dies potenziell zu einer Retraumatisierung führen kann. In Anbetracht des Mangels an Informationen über die Praxis der Einbeziehung Betroffener wurden insgesamt mehr als 100 Organisationen der Zivilgesellschaft (meist über LSI und GAATW vernetzte Organisationen europa- und weltweit) gebeten, einen kurzen Online-Fragebogen auszufüllen, zudem kontaktierten die Autorinnen zahlreiche Organisationen auf lokaler Ebene, die sich für Betroffene von Menschenhandel und anderer Gewaltformen einsetzen.
Studie zur Beschlagnahmung von Erträgen des Menschenhandels
Artikel 23(3) der Konvention des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels verpflichtet die Vertragsstaaten Maßnahmen zu ergreifen, die es ihnen ermöglichen, die Tatwerkzeuge und Erträge aus Menschenhandelsdelikten zu beschlagnahmen. Die Umsetzung des Übereinkommens wird von der unabhängigen Expert*innengruppe (GRETA), überwacht, die bei der dritten Evaluierungsrunde des Übereinkommens den finanziellen Aspekten des Menschenhandels besondere Aufmerksamkeit schenkt.
Eine neue thematische Studie „The financial approach to combatingtrafficking in human beings“, klärt den Anwendungsbereich von Artikel 23(3) des Übereinkommens und zieht eine Bilanz seiner Umsetzung durch die Vertragsstaaten auf Grundlage der von GRETA veröffentlichten Berichte. Es werden Empfehlungen ausgesprochen, um sicherzustellen, dass die internationalen Verpflichtungen in Bezug auf die finanziellen Aspekte der Bekämpfung des Menschenhandels besser verstanden und in die Praxis umgesetzt werden.
Digitale (Ex-)Partnerschaftsgewalt in Frauenhäusern
Im Rahmen ihres Projekts „Digitaler Gewalt im Frauenhaus handlungssicher begegnen“ hat die Frauenhauskoordinierung e.V eine Übersicht zum Thema „Digitale (Ex-)Partnerschaftsgewalt in Frauenhäusern“ entwickelt. Die Handreichung richtet sich an Fachkräfte aus dem Gewaltschutz und angrenzender Berufsfelder, politische Entscheidungsträger*innen sowie Journalist*innen. Sie bietet Interessierten eine Einführung in das Thema und zeigt praxisorientierte Ansätze auf, wie Fachkräfte in Frauenhäusern und im Unterstützungssystem mit digitaler Gewalt umgehen und betroffene Frauen wirksam schützen können. Digitale (Ex-)Partnerschaftsgewalt stellt eine zunehmende Herausforderung in Frauenhäusern dar. Immer mehr Bewohnerinnen* im Frauenhaus erleben digitale Gewalt. Täter nutzen in gewaltvollen (Ex-)Partnerschaften digitale Mittel, um Kontrolle und Überwachung über die Betroffenen auszuüben. Digitale (Ex-)Partnerschaftsgewalt tritt dabei häufig gemeinsam mit körperlicher Gewalt in Erscheinung.
NEUIGKEITEN AUS DER KOK-RECHTSPRECHUNGSDATENBANK
Flüchtlingseigenschaft bei von Zwangsheirat und Genitalverstümmelung betroffener Senegalesin
Das Verwaltungsgericht Bremen sieht in seiner Entscheidung vom 02.12.2024 im Falle einer von Zwangsehe und Genitalverstümmelung betroffenen Senegalesin und ihrer Tochter trotz Einstufung des Senegals als sicheren Herkunftsstaat die Nichtverfolgungsvermutung widerlegt und spricht der Klägerin und ihrer Tochter mit umfassender Begründung die Flüchtlingsanerkennung zu.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) lehnte die Anträge zunächst als unbegründet ab.
Auf die Klage der Frauen hiergegen, stellt das VG fest, im Falle der Klägerinnen wirke sich der Streit um die Einstufung des Senegals als sicherer Herkunftsstaat nicht aus, da sie durch ihr Vorbringen die im Falle eines sicheren Herkunftsstaates angenommene Nichtverfolgung gem. § 29 Asylgesetz (AsylG) schlüssig widerlegt hätten.
Die Mutter sei aufgrund der Zwangsehe bereits vorverfolgt ausgereist. Nach dem Tod des Zwangsehemannes drohe ihr Gewalt durch die Familie des Mannes und erneute Zwangsverheiratung. Zwangsverheiratung stelle eine geschlechtsspezifische Verfolgung dar. Eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe könne nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH vom 16.01.2024) auch allein an das Geschlecht anknüpfen und dies träfe auf die Frauen im Senegal zu, da ihnen dort eine minderwertige Identität zugesprochen werde und sie Diskriminierungen und sexuellen Übergriffen schutzlos ausgeliefert seien.
Das VG verweist auf die sog. Istanbul-Konvention, nach der Gewalt gegen Frauen aufgrund ihres Geschlechts als Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention einzustufen sei.
Ältere Newsletter finden Sie im Archiv >>